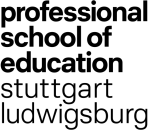Begabung, Kreativität, Teilhabe: Potenziale in der künstlerischen und kulturellen Bildung.
Interdisziplinäres Symposium am 9.-11. Oktober 2025, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg
Im Rahmen des Symposiums rücken wir den Zusammenhang von Begabung, Kreativität, Teilhabe in künstlerischer und kultureller Bildung in den Fokus unserer interdisziplinären Betrachtung. Das Verständnis dieses dynamischen Gefüges ist für die Gestaltung zeitgemäßer Bildungsprozesse von zentraler Bedeutung. Unser Ziel ist es, die komplexen Wechselbeziehungen in diesem Gefüge zu analysieren und die daraus resultierenden Konsequenzen für die pädagogische Praxis eingehend zu diskutieren.
Für die Teilnahme am Symposium ist eine Gebühr erforderlich:
- Kostenfrei für Studierende
- 30€ für Referendare
- 60€ für alle anderen Teilnehmer/-innen
Zahlungsempfänger: LOK BA-WÜ / PH Ludwigsburg IBAN: DE02 6005 0101 7495 5301 02 Verwendungszweck: 1369710065704 Symposium PH Ludwigsburg
Begabung als Entwicklungspotenzial: Begabung wird heute als Entwicklungspotenzial verstanden, das durch geeignete pädagogische Interventionen zur Entfaltung gebracht werden kann. Im Kontext der künstlerischen und kulturellen Bildung manifestiert sich Begabung in vielfältigen Formen, die über traditionelle Vorstellungen hinausgehen. Die Identifikation und Förderung künstlerischer Begabungen erfordert differenzierte diagnostische Fähigkeiten, angemessene Entwicklungswege und individualisierte Förderansätze.
Kreativität als Schlüsselkompetenz: Kreativität, ein vielschichtiges Konstrukt mit kognitiven und persönlichkeitsbezogenen Aspekten, wird zunehmend als Schlüsselkompetenz für die Bewältigung und Gestaltung komplexer zukünftiger Herausforderungen angesehen. In der künstlerischen Bildung nimmt die Kreativitätsförderung traditionell eine zentrale Rolle ein. Neuere Forschungsansätze rücken die Wechselwirkungen zwischen kreativen Prozessen und domänenspezifischen Fähigkeiten in den Fokus.
Teilhabe als Ziel von Bildungsprozessen: Grundsätzlich ist gesellschaftliche Teilhabe das Ziel aller Bildungsprozesse. Jenseits der programmatischen Ansprüche und normativen Grundlagen im aktuellen Teilhabe-Diskurs steht die Frage im Fokus, wie in künstlerischen und kulturellen Bildungsprozessen die vielfältigen Lebenslagen und Differenzlinien wie beispielsweise Behinderung, soziale Herkunft, Migration und Geschlecht als Barrieren wirken können? Auf welche Weise eine diversitätssensible Teilhabe an qualitativ hochwertiger Bildung in diesem Feld die vorhandenen Fähigkeiten erweitern und ergänzen kann, wird im Symposium mehrperspektivisch ausgelotet.
Künstlerische und kulturelle Bildung als Rahmen für Entfaltung: Die künstlerische und kulturelle Bildung bietet einen einzigartigen Rahmen für die Entfaltung von Begabung und Kreativität. Sie ermöglicht Freiräume für kreative Exploration bei gleichzeitiger Vermittlung künstlerischer Grundlagen. Aktuelle Konzepte betonen die Bedeutung künstlerischer Denk- und Handlungsprozesse für die Persönlichkeitsentwicklung und Bildungsprozesse Menschen aller Lebensalter und zielen auf eine umfassende Förderung ab, die über rein gestalterische Aspekte hinausgeht.
Die Förderung von Kreativität und Begabung ist somit ein zentrales Anliegen von kultureller und künstlerischer Bildung. In diesem Symposium wollen wir aktuelle Erkenntnisse aus Forschung und Praxis zusammenführen und interdisziplinäre Perspektiven integrieren. Wir laden AkteurInnen aus der Wissenschaft und der Lehrkräftebildung, aus der schulischen und außerschulischen sowie künstlerischen Praxis dazu ein,
sich bezüglich der Konzepte von Kreativitäts- und Begabungsförderung auszutauschen sowie innovative Ansätze vorzustellen und gemeinsam zu diskutieren. Dabei geht es um einen wertvollen Dialog zwischen Theorie und Praxis. Lehrkräfte und PädagogInnen spielen eine Schlüsselrolle beim Erkennen und der Förderung von Kreativität und Begabung. Ihre Professionsentwicklung für diesen Bereich ist daher von großer Bedeutung.
Gleichzeitig geht es bei diesem Symposium darum, eine weitere Intensivierung der transdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Kreativitäts-, Begabungs- und kunstpädagogischer Forschung zu stärken, um das Potenzial künstlerischer und kultureller Bildung für die Entfaltung kreativer und besonderer Begabungen besser auszuschöpfen und Konzepte für die Bildungspraxis zu entwickeln.
Die Symposium wird eine Plattorm bieten, um folgende Aspekte zu diskutieren:
- Aktuelle Forschungserkenntnisse zur Kreativitäts- und Begabungsförderung im Kontext künstlerischer und kultureller Bildung
- Innovative Lehrkonzepte für Schulen und Hochschulen, die Begabung und Kreativität gezielt fördern
- Wege zur barrierefreien Teilhabe in Kunst und Kultur
- Inter- und transdisziplinäre Perspektiven und ihre Bedeutung für die künstlerische Bildung
- Herausforderungen und Lösungsansätze bei der Implementierung kreativitäts- und begabungsfördernder Konzepte
- Innovative und inspirierende Ansätze, die auf der Symposium vorgestellt werden könnten, umfassen beispielsweise: Integration digitaler Medien in kreative Lernprozesse, ko-kreative und kollaborative Lernformen, fächerübergreifende Projekte zur Förderung und Entwicklung des kreativen Denkens
Das Symposium richtet sich an Lehrkräfte aller Schulformen, DozentInnen der Lehrkräftebildung, PädagogInnen aus den Domänen Kunst, Musik, Sport, Tanz, Bewegung, Theater, Literatur, Bildungsforschende, Kunstschaffende und alle, die sich für kreative künstlerische und kulturelle
Bildungsprozesse begeistern. Mit dem Symposium bieten wir die Möglichkeit, sich mit KollegInnen auszutauschen, neue Impulse für die eigene Arbeit zu gewinnen und an der Weiterentwicklung der
künstlerischen und kulturellen Bildung mitzuwirken.
Wir freuen uns darauf, mit Ihnen gemeinsam neue Perspektiven für die Kreativitäts- und Begabungsförderung zu entwickeln und laden Sie herzlich ein, Teil dieses inspirierenden Austauschs zwischen Forschung und Praxis zu werden.
Das Leitungsteam
Prof. Dr. Monika Miller, Vertr.-Prof. Dr. Katja Brandenburger, Dr. Olga Bonath und Prof. Dr. Sven Sauter
Empfohlene Unterkunft:
Für "Campuszwei" (Hotel & Boardinghouse in Ludwigsburg) wurde ein Kontingent gebucht.
https://www.campuszwei.com/