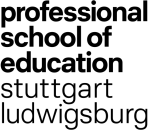Cultural Leadership Lab
Im Cultural Leadership Lab ist Raum für lautes Denken, über Cultural Leadership und Zusammenarbeit in Kulturorganisationen, über Transformationsprozesse und ihre Stolpersteine genauso wie über gelungene Ideen und Beispiele aus der Praxis.
Dieser Blog wird geführt von Prof. Dr. Andrea Hausmann und enthält Beiträge, die auf LinkedIn veröffentlicht wurden.
Mythos Konflikte (4): Nicht so schlimm, der Streit betrifft nur uns zwei
In der Praxis findet sich immer mal wieder das Phänomen, dass selbst chronische Konfliktkonstellationen unter Führungskräften als nicht so dramatisch eingeschätzt werden. Stattdessen wird davon ausgegangen, dass, wenn „die anderen“ nicht direkt beteiligt seien, ergo alles nicht so schlimm sei. Diese Annahme, dass Auseinandersetzungen auf die unmittelbar Beteiligten begrenzbar seien, ist in Systemen allerdings ein Mythos.
Vereinfacht illustrieren lässt sich das am für Kulturorganisationen nicht ganz untypischen Fall eines dauerhaft konflikthaften Verhältnisses zwischen zwei Führungskräften im Top Management, z. B. im Rahmen einer Doppelspitze.
Wird hier an der Spitze immer wieder darum gerangelt, wer die Macht hat, wer was entscheidet, wer wie über die Ressourcen verfügt, dann dauert es nicht lange, bis erst die anderen Führungskräfte, dann andere Mitarbeitende und am Schluss die ganze Organisiert von den Spannungszuständen infiziert sind. Die „Krankheitssymptome“ bei den anderen können dabei unterschiedlich sein, häufig reagieren sie jedoch mit Angst, Unsicherheit, Vermeidungsverhalten und "work arounds".
Konflikte lassen sich mit einem Kiesel vergleichen, der ins Wasser geworfen wird – nicht immer, aber häufig entstehen konzentrische Kreise. Es gilt: Je heftiger, anhaltender, dysfunktionaler der Konflikt ist, desto mehr wirkt er über die eigentlichen Streitparteien hinaus und in die Organisation hinein.
Warum das so ist? Das werde ich in dieser Reihe noch ausführlicher betrachten. An dieser Stelle soll genügen, dass Konflikte dazu neigen, die Allianzen- und Lagerbildung zu fördern – und damit zu spalten.
Fazit: Besser nicht systematisch unterschätzen, wie ansteckend Konflikte sein können – und wie schnell sie als Virus, das Bild bietet sich in dieser Jahreszeit an, durch die Organisation gereist sind.
Dezember 2025
Mythos Konflikte (3): Konflikte sind (dys)funktional
Nachdem ich seit dem letzten Post zum Thema selbst ordentlich damit beschäftigt war, dem ein oder anderen Spannungszustand Aikido-artig auszuweichen (nicht immer gelungen) oder möglichst klug zu regulieren (das mögen andere beurteilen), kann es hier nun endlich weitergehen mit dem Aufräumen von Mythen... Dazu gehört die in Workshops häufig gestellte Frage, ob Konflikte tatsächlich funktional sein können – oder nicht immer dysfunktional sind.
Die Antwort ist: Es kommt darauf an.
Eine Dysfunktion bedeutet es gibt eine Funktionsstörung. Das führt zu der Frage, welche Funktionen Konflikte überhaupt haben können – und für wen. Einige Beispiele:
- Organisation und Organisationsentwicklung: Durch einen bestimmten Konflikt und die Maßnahmen zu seiner Regulierung werden Abläufe und Strukturen verbessert.
- Individuum und persönliche Entwicklung: Wenn Einzelne die „Tanzschritte“ aus Störungen ansprechen – Gegenwind aushalten – von eigenen Maximalforderungen ablassen – die anderen auch in ihren Ansichten sehen etc. oft genug geübt haben, dann gehören diese nicht nur zu einem lebendigeren, selbstbestimmteren Arbeitsalltag und können Spaß machen, sondern es wird auch die eigene Persönlichkeit entwickelt.
- Team und Teamentwicklung: Ein Team, das Konflikte gemeinsam bewältigt, wird ambiguitätstoleranter, kann mit unterschiedlichen Perspektiven konstruktiver umgehen, kann Stürmen besser trotzen, hält im Idealfall mehr zusammen.
Konflikte geben also durchaus wertvolle Impulse. Gleichzeitig gilt aber auch: Das ist kein Selbstläufer! Ein Konflikt, der von der Abteilungsleiterebene in die jeweiligen Teams verschoben wird und dort wegen fehlender Kompetenzen nicht aufgelöst werden kann, ist nicht funktional. Ein Konflikt, der auf der Sachebene überfällig ist, kann wegen einer Verstrickung auf der Beziehungsebene hochdysfunktional werden.
Fazit: Konflikte sind nicht per se dysfunktional oder funktional. Es kommt immer darauf an, wie sich die Konfliktsituation, auch über den Zeitablauf hinweg, konkret gestaltet. Klar ist nur, dass es sich lohnt, in funktionale Konflikte zu investieren, hier den Energieaufwand des Rangelns um eine bessere Lösung in Kauf zu nehmen. Bei dauerhaft dysfunktionalen Konflikten kann es jedoch unumgänglich werden, Verantwortung für sich zu übernehmen, eine Exit-Strategie zu wählen und das Konfliktfeld – temporär oder dauerhaft - zu verlassen.
November 2025
Mythos Konflikte (2): Konflikte sind vermeidbar
Die Forschung unterscheidet verschiedene Konflikttypen bzw. Konfliktstile. Eine modellhafte Kategorie sind konfliktvermeidende Personen, wenngleich wir alle natürlich keine Modelle sind, sondern häufig Mischwesen. D.h. es kann auch sein, dass wir nur bestimmte Konfliktsituationen vermeiden, in andere aber „head-on“ gehen.
Wie auch immer: Haben Konfliktvermeider*innen, überspitzt formuliert, vielleicht einen Vorteil in der Arbeitswelt, weil sie Konflikten aus dem Weg gehen und damit möglicherweise viel Energie sparen, die ansonsten für Gezanke, Machtkämpfe, Eskalationen etc. draufgeht?
Nehmen wir ein einfaches Beispiel: Sie blicken gemeinsam mit dem Kollegen auf die Zukunft der Kulturorganisation. Was Sie sehen, sind unterschiedliche Ziele am Horizont, die sich auch nicht so ohne weiteres miteinander vereinbaren lassen.
Ist jetzt eine Auseinandersetzung mit dem Kollegen um die Setzung von Zielen vermeidbar?
Warum nicht. Sie könnten dem Kollegen den Vortritt lassen und sich mit seiner Priorisierung anfreunden.
Das könnten Sie machen, dann wäre ein Konflikt vermieden - jedenfalls für den Moment. Aber es gilt auch: Dann werden Ihre Ziele und guten Ideen eben nicht mehr verfolgt oder jedenfalls nicht in der Priorisierung, die Ihnen vor dem Gespräch wichtig war.
Hier gilt es dann abzuwägen, wie bedeutsam es für Sie und in diesem Fall auch für die Organisation insgesamt ist, dass Ihre Position Gehör findet und vielleicht sogar in Teilen oder zur Gänze umgesetzt wird.
Vielleicht weil Sie wissen, dass Sie ein gutes Marktgefühl haben und bestimmte Marktentwicklungen (besser) absehen können. Vielleicht auch aus anderen, auch weniger sachorientierten Gründen.
Fazit: Überall dort, wo Menschen mit unterschiedlichen Erwartungen und Bedürfnissen aufeinandertreffen, sind Konflikte normal und unausweichlich. Und auch das Vermeiden von Konflikten kostet Energie. Der Fokus sollte daher weniger darauf liegen, Konflikte zu vermeiden, sondern darauf, sie, wenn sie unvermeidlicherweise entstanden sind, klug zu regulieren.
November 2025
KI & Cultural Leadership (1): Am Ball bleiben
Keine Woche vergeht, ohne dass ich mich frage: Warten? Aufspringen? Teilstrecke mitfahren? Der KI-Zug fährt jedenfalls mit Volldampf, so viel ist sicher und da wir am Institut für Kulturmanagement Ludwigsburg den Anspruch haben, „am Ball zu bleiben“, möchte ich in dieser Reihe, Gedanken und Literaturempfehlungen zur Frage teilen, was KI eigentlich für die Führung in Kulturorganisationen bedeutet. Wohlwissend, dass der „Ball KI“ hoch und weit springt, das Ganze also eine sportliche Angelegenheit werden kann.
Beginnen möchte ich heute mit der Grundsteinlegung, das scheint mir auch in der brave new world von KI noch immer eine gute Idee zu sein:
KI bezeichnet – kurz gefasst – die Fähigkeit von Computersystemen, Aufgaben zu lösen, die menschliche Intelligenz erfordern, wie z. B. Lernen, Schlussfolgern, Wahrnehmen oder Sprachverstehen. KI gilt als Schlüsseltechnologie für die digitale Transformation in Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft. Den entscheidenden Durchbruch für KI-Anwendungen in der Praxis brachte das „maschinelle Lernen“, bei dem Algorithmen Muster anhand von Daten erkennen und ihre Leistung durch Anpassung der Modellparameter verbessern. Moderne KI-Systeme können sehr große Datenmengen analysieren, natürliche Sprache verarbeiten, Muster und Bilder erkennen sowie auf dieser Basis Vorhersagen treffen oder, in bestimmten Anwendungen (z. B. Robotik, autonomes Fahren), auch teilautonom handeln.
Was aber bedeutet dies alles für das Cultural Leadership, d. h. für die Führung in Kulturorganisationen? An welchen Stellen im Aufgabenspektrum von Führungskräften – also z. B. beim Planen und Treffen von Entscheidungen, beim Einsatz von Ressourcen, beim Definieren und Verfolgen von Zielen oder bei der Regulierung von Konflikten – kann KI tatsächlich (sinnvoll) unterstützen und verbessern? Und wo auch gerade nicht? Im nächsten Post zu dieser Reihe wird es darum gehen, einen kursorischen Überblick zum Status quo der Forschung zu geben.
Literatur: Schmiedchen, F./ Gernler, A./Hafner, M./Kratzer, K.P. (Hrsg.). Künstliche Intelligenz und Wir, Springer; Springer; Hausmann, A./Zischler, L. (2023). Leadership in Arts Organisations. The Power of Successful Work Relationships, MacMillan.
November 2025
Mythos Konflikte (1): Von was zu reden sein wird
Bei der Begleitung von Transformationsprozessen, in unseren Weiterbildungsseminaren und im Coaching von Führungskräften komme ich immer wieder ins Gespräch mit Personen, die an ihrer Konfliktkompetenz zweifeln, etwa weil sie bestehende Konflikte nicht (mehr) eingefangen bekommen oder notwendige Konflikte gar nicht erst eingehen und die deswegen ihr Skill Set erweitern möchten. Aus diesem Grund werde ich hier auf LinkedIn in lockerer Reihenfolge Gedanken und Literaturempfehlungen zu diesem so wichtigen Thema im Cultural Leadership teilen.
Aber wann sprechen wir von einem sozialen Konflikt im Arbeitskontext? In einer sehr kurzen Version: Wenn eine Erwartungsdifferenz vorliegt. Ich also z. B. an die Verwendung von knappen Ressourcen eine andere Erwartung als der Kollege habe.
Die Zutaten in der längeren Version: Wenn zwei oder mehr Personen, die im Rahmen ihrer Tätigkeit voneinander abhängig sind, eine Spannungssituation bzw. Unvereinbarkeit erleben, weil unterschiedliche Bedürfnisse vorliegen, die nicht gleichzeitig in einem für alle optimalen (oder zumindest befriedigendem) Maße realisiert werden können und mindestens eine der Konfliktparteien das als so beeinträchtigend erlebt, dass sie das nicht akzeptieren kann.
Eine der häufigsten Fragen in diesem Zusammenhang ist die, ob sich Konflikte nicht doch „irgendwie“ vermeiden lassen, z. B. durch die Strategien „mehr“ und „besser“: Mehr Kommunikation, mehr Zuhören, mehr Verständnis, bessere Abläufe, bessere Vorgaben, bessere Vorlagen etc.
Kann das funktionieren? Stay tuned for #2.
Literatur: Glasl, F. (2024): Konfliktmanagement. Ein Handbuch für Führung, Beratung und Mediation, 13. Aufl., Haupt: Bern; Sprenger, R.K. (2020): Magie des Konflikts: Warum ihn jeder braucht und wie er uns weiterbringt, DVA: München.
November 2025
Leadership in a Nutshell (16): Im Team mehr leisten?
Heute ist bei uns was los: Wir haben Verantwortliche aus 15 Häusern zu Gast und werden uns anderthalb Tage lang damit beschäftigen, was es braucht, um Teams zu verstehen, zu führen und zu entwickeln. Normalerweise geht das Institut für Kulturmanagement Ludwigsburg für Schulungen in die Kultureinrichtungen selbst, und so freue ich mich, zur Abwechslung mal Gastgeberin sein zu dürfen.
Teamarbeit ist die Kunst, miteinander die besten Lösungen zu finden, um zusammen Ziele zu erreichen. Funktionierende Teams haben einerseits die Fähigkeit, sich selbst zu organisieren, andererseits braucht jedes Team punktuelle Nadelstiche – Aufgabe von Führung ist es, Interventionsbedarfe zu erkennen und Hilfe zur Selbsthilfe zu geben.
8 zugespitzte Thesen zum Thema:
- Die Fähigkeit zur Zusammenarbeit ist ein Schlüsselfaktor für die Leistungsfähigkeit und sorgsame Ressourcennutzung von Organisationen in der Kultur.
- Die Arbeit im Team hat eine organisationale Perspektive: Die Komplexität der Produkte von Kultureinrichtungen macht Zusammenarbeit unerlässlich. Gerade aber die abteilungsübergreifende Teamarbeit ist oft gestört und führt zu Mehrarbeit, Qualitätsverlusten, hohem Koordinationsaufwand etc.
- Die Arbeit im Team hat eine individuelle Perspektive: Zusammenarbeit fördert die eigene Entwicklung, wir profitieren von den Kompetenzen, Blickwinkeln und Fähigkeiten der anderen. Das Ganze ist mehr und etwas anderes als die Summe seiner Teile!
- Dazu braucht es viel Beziehungsarbeit. Das ist oft identitätsstärkend, anregend und macht Spaß. Die meisten Menschen mögen Zugehörigkeit und Bindung.
- Teamarbeit bedeutet aber immer auch Abhängigkeit von anderen – in zeitlicher, inhaltlicher etc. Hinsicht. Das kann viel Frust erzeugen. Ohne Konfliktkompetenz gibt es entweder Friedhofsruhe oder Boxarena - beides ist für Organisation und Team suboptimal.
- Alle Teams haben Spielregeln, die definieren, wie sich die Mitglieder zu verhalten haben. Manchen Regeln werden offen definiert sein (z. B. in Workshops, im Leitbild), vieles wird im Verborgenen wirken. Diese Regeln können sinnvoll oder toxisch sein – manchmal kann man das nur noch von „außen“ erkennen.
- Vertrauen, Commitment, Verantwortlichkeit, Konfliktresilienz, Ergebnisorientierung – mit diesen Schlagwörtern kann man schon ganz gut die (Dys-)Funktionalität von Teams einschätzen.
- Last but not least: Führungskräfte haben großen Einfluss auf ihr Team – und sollten deswegen nicht zu viel in gesunde gruppendynamische Prozesse reingrätschen, sondern lieber die Selbstwirksamkeit von Teams stärken.
Literatur: Becker, F. (2016). Teamarbeit, Teampsychologie, Teamentwicklung, Wiesbaden. Van Dick, R./West, M.A. (2013). Teamwork, Teamdiagnose, Teamentwicklung. 2. Aufl. Göttingen.
06.10.2025
Leadership in a Nutshell (15): Ohne Konflikt keine Veränderung!
Organisationsentwicklung ist ein Buzzword, das im Austausch mit Führungskräften und Trägern von Kultureinrichtungen regelmäßig fällt. Und das ist erfreulich, zeigt es doch, dass einiges in Bewegung ist – auch wenn noch viel zu tun bleibt.
Zuweilen meine ich aber eine etwas verklärte Perspektive auf solche Prozesse herauszuhören. „Alle sollen mitgenommen werden“, heißt es dann, und eine „kollektive Verständigung hergestellt“. Pauschal wird angenommen, dass sich eine „positive Organisationskultur“ entwickelt und die „Zufriedenheit der Mitarbeitenden“ steigt.
So gut das klingt und so wünschenswert es ist, so möchte ich doch in unserem Kurzformat „Praxisimpulse“ am Institut für Kulturmanagement Ludwigsburg die unbequeme Wahrheit beleuchten, dass Veränderung immer zu einem Preis kommt. Einige Gedanken vorab:
- OE bedeutet Veränderung – Dinge werden künftig anders gemacht als bisher. Das kann sofort neue Energien freisetzen. Manchmal braucht es aber Zeit, um Etabliertes würdig zu verabschieden und ein Einverständnis mit dem Neuen zu erringen. Wo hier mit unterschiedlichen Tempi gelaufen wird, kommt es schnell zu Missverständnissen und Spannungen.
- OE produziert immer Gewinner und Verlierer – das Neue wird manchen Arbeitsbereich entlasten, vielleicht sogar aufwerten. Andere Bereiche oder Personen werden u. U. Ressourcen, Deutungshoheit, Einfluss – real oder gefühlt – verlieren. Prozessverantwortlichen, die hier im Schnellverfahren Entscheidungen durchdrücken, wird schon bald erheblicher Gegenwind entgegenblasen.
- Konflikt in der OE bedeutet: Du willst etwas, das ich (so) nicht will. Die notwendige Umstrukturierung wertet Deine Position auf und meine (real oder gefühlt) ab. So werde ich die Veränderung nicht akzeptieren und das hat Konsequenzen (Blockade des Veränderungsprozesses, Entstehung von Parallelstrukturen, Aufwertung informeller Netzwerke, innere Kündigung etc.).
- Deshalb ist Konfliktkompetenz gefragt bzw. die Fähigkeit, Konflikte regulieren zu können – und damit ihre positive Kraft zu nutzen. Prozessverantwortliche, Leitungspersonen etc. nehmen anhaltende Spannungen ernst und werten Emotionen (z. B. Verärgerung, Gefühle des Ausgeschlossenseins oder Nicht-Gesehen-Werdens) nicht vorschnell als Empfindlichkeit ab. Vielmehr wird überlegt, ob und wo Schleifen neu gedreht, Gespräche gesucht und Alternativen geprüft werden müssen.
Fazit: Wo gehobelt wird, fallen Späne. Veränderungsprozesse produzieren (immer auch) Destabilisierung, Unsicherheit, Spannung. Realistische OE, die am Ende tatsächlich Teamkultur und Zufriedenheit fördert, fakturiert das von Beginn an ein und geht Konflikten nicht aus dem Weg.
Literatur: Eidenschink, K. (2025). Kein Konflikt, kein Change. In: managerSeminare 327, Juni 2025; Hausmann, A./Zischler, L./Braun, O. (2025). Organisationsentwicklung in Kulturbetrieben - Leitfaden für nachhaltige Veränderungsprozesse. Springer: Wiesbaden.
04.10.2025
Cultural Leadership Skills (6): Ambiguitätskompetenz
Wirksame Führung braucht Kompetenzen. Unser Weiterbildungspaket „Leadership & Transformation“ setzt genau da an. In der Reihe „Cultural Leadership Skills“ stelle ich in lockerer Reihenfolge Schlüsselkompetenzen vor, die in der Praxis von Kulturorganisationen gebraucht werden und im Fokus unserer Seminare stehen.
Nach meinen Posts zu (2) Kooperationskompetenz, (3) Diversitätssensibilität, (4) Entscheidungskompetenz und (5) Kommunikationskompetenz, geht es heute um (6) Ambiguitätskompetenz.
Unsere Arbeitswelt ist komplex, hochdynamisch und in vielen Entscheidungssituationen gibt es keine eindeutigen Antworten. Daher braucht es im Leadership die Kompetenz, Mehrdeutigkeiten, Unsicherheiten und Widersprüchlichkeiten nicht sofort auflösen und beseitigen zu wollen, sondern sie vielmehr auszuhalten, zu reflektieren und möglichst produktiv zu nutzen.
Eine solche Ambiguitätskompetenz ist gerade auch in Kulturorganisationen essenziell für den Erfolg von Führung. Denn hier treffen systembedingt unterschiedlichste Perspektiven, Werte und Erwartungen aufeinander, die Komplexität ist aufgrund der Akteursdichte besonders hoch und auch die Widersprüchlichkeit ist Teil der DNA von Kulturorganisationen.
Wie aber die eigene Ambiguitätskompetenz stärken? Dafür habe ich drei Empfehlungen für Führungskräfte:
- Dialog fördern und Vielfalt nutzen: Räume schaffen, in denen unterschiedliche Perspektiven offen geteilt werden bzw. interdisziplinäre Teams bewusst einsetzen, um komplexe Fragestellungen aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten.
- Unsicherheit zulassen: Entscheidungen mutig auch dann treffen, wenn nicht alle Informationen vorliegen oder sie nicht eindeutig sind. Transparent mit dieser Unsicherheit umgehen und auch Zwischenschritte oder offengebliebene Fragen in die Organisation kommunizieren.
- Orientierung trotz Unklarheit geben: auch wenn nicht alle Antworten feststehen können Führungskräfte durch klare Haltung, nachvollziehbare Prioritäten und eine offene Kommunikation Halt bieten, sodass Teams Ambiguität als gestaltbar und weniger bedrohlich erleben.
Fazit: Ambiguitätskompetenz ist ein weiteres Steinchen im Puzzle wirksamer Führung: Wer als Führungskraft weitgehend unerschrocken auf Komplexität, Unsicherheit und Wandel reagiert und die Mehrdeutigkeit von Situationen als gegeben akzeptiert, der/die bleibt länger handlungsfähig und hat mehr Ressourcen für kreative Lösungen.
Mehr zum Thema finden Interessierte bei Weibler, J. (2021): Personalführung, 4. Aufl. Vahlen; Hausmann, A./Zischler, L. (2024): Leadership in Arts Organisations, MacMillan und Ulf-Daniel Ehlers (NextEducation) (2020). Future Skills, Springer.
21.08.2025
Leadership in a Nutshell (14): Führung ist nicht gleich Hierarchie
Wenn es so langsam Richtung Herbst geht, bin ich gedanklich meist mit meinem Weiterbildungsseminar zu Leadership und Führungskompetenzen in Kulturorganisationen beschäftigt, das ja doch jährlich hübsch gemacht werden will. Und ich bin immer dankbar für neue Perspektiven und Auffrischung von Bekanntem in meinem Herzensthema. Dabei schätze ich es auch, wenn ich als Betriebswirtin mit Terminologien aus anderen Disziplinen (hier: Soziologie) alte Pfade neu erkunden kann.
Schon etwas länger liegt auf meinem Schreibtisch das Buch „Führung managen. Eine sehr kurze Einführung“ von Stefan Kühl und Judith Muster, woraus wir im Seminar u.a. Folgendes intensiver diskutieren werden:
Führung hat drei Richtungen:
- Führung ist Einflussnahme von oben nach unten, d.h. durch Hierarchie werden Führungsansprüche formalisiert.
- Führung ist aber auch die Einflussnahme zur Seite. „Laterale Führung“ entsteht immer dann, wenn links und rechts auf der Hierarchieebene Einfluss genommen wird - ohne Weisungsbefugnis/disziplinarische Verantwortung.
- Am wenigsten im Blick behalten wir m. E. in der Praxis, dass auch Mitarbeitende Vorgesetzte führen. Statt „Überwachung“ also „Unterwachung“ aufgrund der Nutzung eigener Expertenmacht, die Kontrolle über Informationen, die Verwendung von sonstigen Ressourcen, wie z. B. Zeit.
Führung ist nicht gleich Hierarchie:
Aus den Punkten 1-3 wird klar, dass sich Führung eben gerade nicht (nur) aus hierarchischer Stellung ableitet. Führen kann prinzipiell jede*r. Das ist so lange unproblematisch (oder sogar gut für die Organisation), so lange mit der Führung auch Verantwortungsübernahme und Zurechenbarkeit einhergeht und Transparenz vorliegt.
Und noch eine Sache, bei der ich nur zu gerne zustimme: Die Tendenz, Führung, diesen großen Begriff, mit Adjektiven beliebiger Art weiter aufzuladen. Besonders allergisch reagiere ich persönlich tatsächlich auf "transformative Führung", nicht, dass ich gegen Transformation wäre, ganz im Gegenteil. Aber ich wünschte mir, die Führung wäre gerade bei großen Veränderungsbedarfen und Change-Prozessen, wie ich sie grundsätzlich verstehe: Zuverlässig, richtungsgebend, mutig, wertschätzend etc. etc. Dazu passt ein Abschlusszitat aus o.g. Buch: „(…) das Wortgeklingel in Verbindung mit Führung, hat zur Folge, dass immer unklarer wird, worum es eigentlich geht“ (S. 3).
Ich halte fest: Nicht nur eine sehr kurze, sondern auch eine sehr kluge Einführung!
Lust, am 6./7. November 2025 (online) mitzulernen und zu diskutieren? Dann wäre die Richtung hier lang.
15.08.2025
Leadership in a Nutshell (13): Erfolg ist alles!

Wann ist Führung eigentlich erfolgreich? Das ist eine Frage, die schon in vielen Studien untersucht worden ist und allgemein als schwierig zu beantworten gilt. Denn so wichtig Führung auch ist, ihre tatsächliche Wirkung ist nicht so leicht zu erfassen. So ist etwa kein Zeitpunkt und keine Effektstärke bestimmbar, ab dem sich eine Intervention der Führungskraft auf das Verhalten oder die Performance von Mitarbeitenden oder Teams (spätestens) zeigen müsste.
Was nun tun, wenn man für sich aber gerne wissen möchte, ob das, was man da so den lieben langen Tag an Führung produziert, irgendwie auch Sinn und Zweck hat.
Nun lassen sich solchen Fragen immer Zahlen zugrunde legen. In meinem Fall wären das Studierendenzahlen, Teilnehmende an unserer Weiterbildung, Drittmittelquoten, Publikationen etc., für Kulturorganisationen wären es z. B. Zahlen zu durchgeführten Ausstellungen, Lesungen oder zum Anteil der unter 20jährigen am Publikum. Die Frage nach dem Erfolg von Führung würde hier also beantwortet mit dem (messbaren) Output der Organisation. Das ist sinnvoll und existenzsichernd. Und gute Zahlen machen gute Laune!
Der Erfolg von Führung kommt aber auch auf eher leisen, weniger quantifizierbaren Sohlen daher und zeigt sich z. B. unverhofft in einem Gespräch mit Mitarbeitenden, in dem die Lust des Gegenübers an seiner eigenen Tätigkeit zu spüren ist. Und aus dem ich herausgehe und erfreut denke, hier brummt jemand gerade sehr zufrieden vor sich hin. Hat die Nuss fast geknackt, die uns schon seit Wochen umtreibt. Ist vielleicht noch die Extra-Meile gelaufen, die es brauchte, um endlich eine Lösung zu finden. Und hier gilt: zufriedene Mitarbeitende machen zufriedene Führungskräfte! („zufrieden“ kann hier übrigens auch gerne gegen „gut“ getauscht werden…)
Insofern zeigt sich Führungserfolg sowohl im Output der Organisation (oder einzelnen Einheiten) als eben auch in der Art und Weise, wie dieser Output erreicht wird.
Und um auf meinen Hook in der Headline zurückzukommen: Natürlich ist Erfolg nicht alles…! Führungserfolg ist ziemlich flüchtig. Und meist zeigt sich erst in Zeiten, in denen Führungskräfte krachend scheitern und an ihrem Umgang damit, was sie wirklich können. Glücklich die, die mit ihrem Team aus Misserfolgen gestärkt hervorgehen.
04.08.2025
Cultural Leadership Skills (5): Kommunikationskompetenz
Wirksame Führung braucht Kompetenzen. Unser Weiterbildungspaket „Leadership & Transformation“ setzt genau da an. In der Reihe „Cultural Leadership Skills“ stelle ich in lockerer Reihenfolge Schlüsselkompetenzen vor, die in der Praxis von Kulturorganisationen gebraucht werden und im Fokus unserer Seminare stehen.
Nach meinen Posts zu (2) Kooperationskompetenz, (3) Diversitätssensibilität und (4) Entscheidungskompetenz, geht es heute um Kommunikationskompetenz, einem Thema, das u.a. auch im Rahmen meines Seminars „Wirksam führen in Kulturorganisationen. Aufgaben kennen, Beziehungen gestalten“ am 6./7. November eine Rolle spielt.
Führungskräfte in Kulturorganisationen müssen jeden Tag neu überlegen, was sie wie an wen kommunizieren (wollen oder müssen). Entscheidungen, Veränderungen, Neuerungen, Fehler, Erfolge, Abschiede, Anfänge – alles bedarf der Vermittlung. Zu späte Kommunikation, die Wahl des falschen Kanals (häufig: per E-Mail statt persönlich, manchmal auch genau umgekehrt…), Personen, die nicht informiert wurden, aber hätten informiert werden müssen – das alles kann schnell zu Spannungen in Arbeitsbeziehungen führen.
Eine ausgeprägte Kommunikationskompetenz oder anders ausgedrückt, die Fähigkeit,
- sicher über Umfang, Kanäle, Adressaten, Kontext und Zeitpunkt zu entscheiden,
- Informationen klar zu vermitteln (Sprachkompetenz),
- Bedürfnisse und Situation der Gesprächspartner*innen im Blick zu behalten,
- Räume für Dialog, Diskurs und Kritik offen zu halten
ist essenziell für den Erfolg von Führung. Wie aber die eigene Kommunikationskompetenz stärken? Dafür habe ich drei Empfehlungen:
- Üben, üben, üben: Selbstreflexion, Feedback einholen und immer wieder nachjustieren.
- Empathiemuskel trainieren. Klarheit ohne Bezugnahme fördert Fehlkommunikation.
- Kommunikationstechniken kennen, ausprobieren, eigenen Style entwickeln
Fazit: Kommunikationskompetenz ist eine weitere Schlüsselqualifikation für Führungskräfte im Kulturbereich. Klare, empathische und zielgerichtete Kommunikation fördert Vertrauen, Orientierung und Zusammenarbeit.
Mehr zum Thema finden Interessierte bei Plate, M. (2021): Grundlagen der Kommunikation: Gespräche effektiv gestalten, 3. Aufl. UTB; Hausmann, A./Zischler, L. (2024): Leadership in Arts Organisations, MacMillan und Ulf Daniel Ehlers (2020). Future Skills, Springer.
28.07.2025
Leadership in a Nutshell (12): Flurfunk – Fluch und Segen zugleich
„Frau Hausmann“, sagte die Referentin eines Theaters zu mir, „wir wollen zu unserem Mitarbeiter*innentag im Herbst einen Workshop zum Thema Kommunikation machen. Vielleicht mit Fokus Flurfunk? Das würde gerade gut zu uns passen“. Ich habe kurz gezögert und dann gerne zugesagt, denn Flurfunk gehört zum Arbeitsleben wie der Fisch zum Wasser. Einige Überlegungen vorab:
Flurfunk ist ein wichtiger Teil der informellen Kommunikation von Kulturorganisationen. Der Begriff bezieht sich auf persönliche Gespräche, die z. B. in der Teeküche, auf dem Gang oder beim Mittagessen stattfinden. Flurfunk wird oft mit Gerüchten und Getratsche gleichgesetzt, kann auch tatsächlich Teil einer unheiligen Gemunkelküche sein und über einige negative Eigenschaften verfügen.
Gefährliche Dynamiken von Flurfunk
- Unzuverlässigkeit von Informationen (einseitig, unvollständig etc.)
- Fehlinformationen und Halbwahrheiten führen zu Fehlentscheidungen
- Gerüchte führen zu Unruhe, Spannungen, Konflikten unter den Kolleg*innen (Wem kann man vertrauen?)
- Unbestätigte Informationen führen zu Misstrauen ggü. der Führung (Halten "die" Informationen zurück?")
- Ablenkung von Kernaufgaben, Demoivation, Leistungsverlut, Krankheit
Wohl deswegen wird dem Flurfunk zuweilen unterstellt, dass er die formelle Kommunikation „stört“ und dass eine gute, aktive Formalkommunikation auch deswegen so wichtig ist, um die informelle Kommunikation zu „steuern“ und zu „minimieren“.
Ich setze die obigen Begriffe deswegen in Anführungszeichen, weil das typische Forderungen aus der Managementliteratur sind, die aber m. E. an der Lebensrealität in Organisationen vorbeigehen. Denn, selbst wenn die Formalkommunikation super funktioniert, so gibt es nun mal eine Lust des Menschen an Narrativen, Stories und „stiller Post“. Und die meisten von uns sind einfach neugierig! Genau in diesem Zusammenhang verfügt Flurfunk über einige wichtige positive Eigenschaften.
Flurfunk als sozialer Kitt
- Ersatz für formalen Informationsfluss (nicht vorhanden, dysfunktional)
- Unterstützung des formalen Informationsflusses (schneller, direkter etc.)
- Erfahrungsaustausch, Abgleich von Wissensständen, Innovationsförderung, ggf. Frühwarnsystem
- Aufbau von und Verbesserung der Zusammenarbeit; Vertrauensbildung
- Stärkung Gemeinschaftsgefühl und Verbundenheit durch ähnliches Erleben, positives Arbeitsklima
Fazit: Flurfunk kann die Lebendigkeit und den Zusammenhalt in Kulturorganisationen fördern und den Informationsfluss verbessern. Entscheidend ist die Qualität des Flurfunks, die immer auch ein Fingerzeig auf die Konflikt- bzw. Organisationskultur ist. Und nicht nur am Mitarbeiter*innentag sollte jede/r für sich eigenverantwortlich überlegen, was es braucht, um durch Erzählungen den sozialen Kitt zu stärken. Und wo Zurückhaltung geboten ist, um die Gerüchteküche nicht (noch weiter) anzuheizen und an Diskreditierungen nicht teilzunehmen. Besser ist: Einen persönlichen Teil zur Sicherung des Hausfriedens leisten!
Stefan Häseli (2015). Erfolgreiche Kommunikation auf dem Büroflur, Haufe;
Andrea Montua (2024). Führungsaufgabe interne Kommunikation, 2. Aufl., Springer.
21.07.2025
Cultural Leadership Skills (4): Entscheidungskompetenz
Wirksame Führung braucht Kompetenzen. Unser Weiterbildungspaket „Leadership & Transformation“ setzt genau da an. In der Reihe „Cultural Leadership Skills“ stelle ich in lockerer Reihenfolge Schlüsselkompetenzen vor, die bei uns im Fokus stehen.
Nach meinen Posts zu (2) Kooperationskompetenz und (3) Diversitätssensibilität, geht es heute um Entscheidungskompetenz, einem Thema, dem ich mich auch am 6./7. November im Rahmen meines Seminars „Wirksam führen in Kulturorganisationen. Aufgaben kennen, Beziehungen gestalten“ widme.
Führungskräfte stehen regelmäßig vor komplexen Herausforderungen. Tagtäglich müssen programmatische, personelle, finanzielle oder organisatorische Entscheidungen getroffen werden – und dies häufig unter erheblichem Zeitdruck.
Eine ausgeprägte Entscheidungskompetenz oder anders ausgedrückt, die Fähigkeit,
- Entscheidungsbedarf wahrzunehmen,
- mögliche Handlungsalternativen zu identifizieren und gegeneinander abzuwägen,
- eine Entscheidung zu treffen und
- dafür die Verantwortung zu übernehmen,
ist daher essenziell für den Erfolg von Führung. Wie aber die eigene Entscheidungskompetenz stärken? Dafür habe ich folgende Empfehlungen:
- Klarheit über eigene Werte schaffen: Es lässt sich leichter zwischen Alternativen entscheiden, wenn Führungskräfte einen inneren Wertekompass haben.
- Perspektivenvielfalt einholen: Die Entscheidungsverantwortung kann häufig nicht delegiert werden. Der Weg hin zur Entscheidung muss allerdings nicht allein beschritten werden. Im Gegenteil: Wohl der Führungskraft, die weiß, welche Fachkompetenz im Team zu Rate gezogen werden kann.
- Entscheidungen üben: Jeder Entscheidungsbedarf führt an eine Weggabelung. Wenn sich Führungskräfte für einen Weg entscheiden, bleibt ein anderer zwangsläufig unerschlossen. Das Auszuhalten fällt leichter, je öfter Entscheidungen getroffen wurden.
- Entscheidungen reflektieren und daraus lernen: Zwangsläufig treffen Führungskräfte auch falsche Entscheidungen. Im Nachhinein ist man häufig schlauer. Wer hier zu lange hadert, verpasst die Gelegenheit, einen Plan zu machen, wie demnächst besser entschieden werden kann.
Fazit: Entscheidungskompetenz ist eine Schlüsselqualifikation für Führungskräfte. Je ausgeprägter diese Kompetenz ist, desto besser für die Zukunftsfähigkeit von Kulturorganisationen. Kluge Führungskräfte fördern diese Kompetenz auch in ihrem Team, damit jede Hierarchieebene befähigt wird, Entscheidungen zu treffen – und zu verantworten.
Mehr zum Thema finden Interessierte bei Hausmann, A./Zischler, L. (2024): Leadership in Arts Organisations, MacMillan und Ehlers, U.-D. (2020). Future Skills, Springer: Wiesbaden.
11.07.2025
Cultural Leadership Skills (3): Diversitätssensibilität
Wirksame Führung braucht Kompetenzen. In der Reihe „Cultural Leadership Skills“ gehe ich auf die vielfältigen, spannenden Inhalte unseres Weiterbildungspakets „Leadership & Transformation“ ein.
Nach meinem Post zu Netzwerkkompetenz geht es heute um die Bedeutung von Diversitätssensibilität, ein Thema dem sich Dr. Hendrikje Brüning Brüning im Juli widmet. Sie ist erfahrene Beraterin und Dozentin und begleitet erfolgreich Veränderungsprozesse mit dem Ansatz der Reflexiven Organisationsentwicklung.
Diversitätssensibilität bedeutet, die Vielfalt von Mitarbeitenden im Hinblick auf heterogene Lebensrealitäten, Identitäten und Backgrounds wahrzunehmen und anzuerkennen. Darin eingeschlossen ist ein offener Blick für eingefahrene Wahrnehmungs- und Denkmuster sowie persönliche Privilegien und die Bereitschaft, sich eigener Stereotypisierungen bewusst zu werden und Vorurteile abzubauen.
Diversitätssensibles Führungsverhalten fördert das Zugehörigkeitsgefühl und die Arbeitszufriedenheit in Teams und unterstützt die Öffnung von Kultureinrichtungen hin zu gesellschaftlicher Vielfalt und Chancengleichheit. Um diversitätssensibles Handeln und Zugehörigkeit in der internen Kultur nachhaltig zu verankern, sollten Führungskräfte
- Zusammenhänge zwischen gesellschaftlichen Strukturen und der persönlichen Haltung verstehen,
- die eigene Haltung, Rolle und Führungspraxis im Umgang mit Diversitätsmerkmalen reflektieren,
- verstehen, wie persönliche Merkmale zu Benachteiligung oder Ausgrenzung führen können – und wie sie sich gegenseitig beeinflussen,
- erkennen, dass diversitätssensible Führung nicht nur durch formale Handlungen & Strukturen, sondern insbesondere auch durch informelles Verhalten geprägt wird.
- verstehen, wie das eigene Verhalten als Führungskraft dazu beiträgt, ein sicheres Arbeitsumfeld und eine wertschätzende Zusammenarbeit zu fördern und welche konkreten Maßnahmen umgesetzt werden können, um ein diskriminierungsfreies Miteinander im Team zu fördern.
Fazit: Diversitätssensibilität ist für Führungskräfte in Kulturorganisationen eine wichtige Kompetenz, weil sie die Grundlage für ein respektvolles, diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld schafft, dadurch Zusammenarbeit, Arbeitszufriedenheit und Performance fördern kann – und sich indirekt auch positiv auf die Zugänglichkeit von Kulturorganisationen für ein vielfältige(re)s Publikum auswirkt.
Mehr zum Thema „Diversity“ finden Interessierte z.B.
... auf der Website des Zentrum für Kulturelle Teilhabe: https://lnkd.in/e3-gSYX6
…im Whitepaper „Erfolgsfaktor kulturelle Diversität und faire Teilhabe“: https://lnkd.in/eMDq8awd
...im Positionspapier der Kulturstiftung des Bundes: https://lnkd.in/epmsKdRH
01.07.2025
Cultural Leadership Skills (2): Kooperationen und Netzwerke
Wirksame Führung braucht Skills. Deshalb haben wir am Institut für Kulturmanagement Ludwigsburg vergangenes Jahr viel Zeit in die Konzeption eines Weiterbildungspakets für Verantwortungstragende im Kulturbereich gesteckt - mit Werkzeugen, die reflektiert eingesetzt werden können und einem Fundament, das Führungskräfte selbstbewusst und situationsgerecht handeln lässt. Ganz wichtig ist dabei die konkrete Anwendungsfähigkeit im Führungsalltag und die Erweiterung und Schärfung des eigenen Handlungsspielraums.
In der Reihe „Cultural Leadership Skills“ gehe ich auf die konkreten Inhalte unserer Kompaktseminare und Short Sessions unseres Weiterbildungspakets „Leadership & Transformation“ ein.
Es geht los mit dem Thema „Kooperationsmanagement und Netzwerke“ bei Nena Sindia Eckelmann als Führungskraft und Expertin in Sachen Networking. Sie ist seit vielen Jahren als Leiterin der Abteilung Development an den Staatstheatern Stuttgart tätig und vermittelt im Juli sowohl Mitarbeitenden als auch Führungskräften wertvolles Know-how zur Identifikation und richtigen Ansprache von Partner*innen.
- Netzwerkkompetenz ist für Führungskräfte entscheidend, um Kooperationen zu initiieren, Fördermittel zu sichern und gemeinsam Neues auszuprobieren. In einem oft ressourcenorientierten, interdisziplinären Umfeld kann der strategische Aufbau von Partnerschaften die Sichtbarkeit und gesellschaftliche Wirkung der eigenen Institution und deren Kulturangebote stärken.
Je nach Größe und personellen Ressourcen der Einrichtung können Führungskräfte in diesem Feld folgende Aufgaben übernehmen:
- Kontakte aufbauen und pflegen – für die eigene Führungsarbeit (z.B. kollegialer Austausch)
- Kontakte aufbauen und pflegen – für die Gesamtorganisation (z.B. gemeinsame Projekte, Kompetenzbündelung)
- Netzwerkkompetenz im Team fördern – Mitarbeitende empowern, Kooperationen aufzubauen (z.B. durch Teilnahme an Veranstaltungen, Tagungen etc.)
- Die Zukunftsfähigkeit der Organisation durch den gezielten Aufbau von Kooperationen stärken – und den fachlichen Diskurs im eigenen Wirkungsfeld partnerschaftlich mitprägen
- Netzwerkziele setzen – Formate für das Kooperationsmanagement finden (z.B. regelmäßiger Jour Fixe zum Thema festlegen und besprechen, welche Kooperationen angestoßen werden sollen)
Fazit: Kooperationen und Netzwerkaufbau sind wichtige Hebel für moderne und nachhaltig erfolgreiche Kultureinrichtungen und ein strategisches Handlungsfeld im Kulturmanagement.
18.06.2025
Cultural Leadership Skills (1): Die Kompetenz, wirksam zu führen
Führung ist in Kulturorganisationen, auch angesichts zunehmender Komplexität und Systemherausforderungen, ein immens wichtiges Thema geworden. Gute, wirksame Führung fördert u. a. Performance, Arbeitszufriedenheit und Teamzusammenhalt, schlechte Führung bewirkt das Gegenteil.
Wie aber kommen Verantwortungstragende in Kulturorganisationen angesichts oft fehlender (fachlicher und/oder praktischer) Vorerfahrungen zu wirksamer Führung?
Dazu braucht es die Entwicklung von Führungskompetenz.
Mit Kompetenz meine ich die Fähigkeit, Wissen und Können (d. h. Fähigkeiten und Fertigkeiten) zu verbinden, um berufliche Handlungsanforderungen zu bewältigen - insbesondere auch in jenen Situationen, die ein nicht routinemäßiges Handeln und Problemlösen erfordern.
Wichtig ist: Kompetenzen i.e.S. lassen sich nicht erlernen – und nicht durch andere vermitteln. Was sich aber erlernen und von uns in der Weiterbildung vermitteln lässt, ist Wissen.
Vor diesem Hintergrund beschäftigen wir uns intensiv damit, welches praxisnahe Wissen es in welchen Themenfeldern braucht, damit Führung in Kulturorganisationen gelingt.
Wir haben uns für folgenden Kanon entschieden, den wir regelmäßig um neue Themen/Formate ergänzen und den ich nachfolgend beispielhaft illustriere:
- Führung i.e.S.: Was sind die Prinzipien, Kernaufgaben und Tools von wirksamer Führung?
- Selbstführung: Was brauchen Führungskräfte, um sich selbst zu organisieren und zu regulieren? Wie bleiben sie dauerhaft leistungsfähig?
- Kommunikation: Wie lassen sich Gespräche effektiv gestalten? Welche Muster, Axiome und Modelle helfen in praktischen Situationen?
- Konflikte: Wann sind Konflikte funktional? Wie lassen sich Konflikte beruhigen und regulieren?
- Teams: Wie lassen sich Teams effektiv zusammenstellen? Wie lässt sich Kohäsion fördern? Wie schwierige Teamdynamiken erkennen?
- Kooperationen: Wie können Netzwerke die eigene Führungsarbeit unterstützen? Wie lässt sich ein strategisches Netzwerk aufbauen?
- Diversität: Welche Chancen und Herausforderungen gibt es? Welche Rolle spielen Führungskräfte im Diversitätsmanagement?
- Nachhaltigkeit: Welche Dimensionen sind für die eigene Organisation relevant? Wie Zukunftsfähigkeit und Systemresilienz fördern?
- Digitale Transformation: Wie den notwendigen Wandel einleiten und eine Kultur von Innovation und Lernbereitschaft fördern? Mit welchen Prozessen und Modellen anfangen?
09.06.2025
Leadership in a Nutshell (11): Heute schon gemeinsam gegessen?
Der World Happiness Report 2025 ist publiziert und enthält wie immer interessante Ergebnisse. Und dabei geht es mir Weiteren nicht darum, wie glücklich oder unglücklich Deutschland im Vergleich mit anderen Ländern ist (Platz 22 von 147), sondern um einen konkreten Happiness-Faktor. Aber der Reihe nach:
Ich nahm im persönlichen Arbeitskontext bei einer Organisationseinheit mit hohem Servicecharakter seit einiger Zeit wahr, dass sich hier der Umgang mit den internen Kunden und Kundinnen um 180 Grad gedreht hatte: Von vorher mürrisch, barsch und unflexibel, hin zu Interaktionen, die nicht nur mich mit gutem Gefühl und einem Lächeln aus dem Kontakt entließen.
Ich war sehr angetan und knobelte berufsbedingt an der Frage herum, was sich da wohl im Leadership verändert haben könnte. Tage später bekam ich eine mögliche Antwort nonverbal geliefert: Das besagte Team saß in stiller Einmütigkeit beim gemeinsamen Frühstück.
Und tatsächlich zeigt die empirische Forschung, und hier kommt der World Happiness Report 2025 wieder ins Spiel, dass gemeinsames Essen Beziehungen stärken und Stress lindern kann. Einige Zitate aus dem Bericht: „Those who share more meals with others report significantly higher levels of life satisfaction and positive affect, and lower levels of negative affect. This is true across ages, genders, countries, cultures, and regions. (...) Meal sharing also appears to be closely related to some, but not all, measures of social connectedness. (...) Social connections are important drivers of happiness“ (S. 59).
Auch wenn es im WHR nicht spezifisch um gemeinsames Essen in der Arbeitswelt geht und noch einiges ungeklärt ist, was die Kausalzusammenhänge des Teilens von Mahlzeiten, des subjektiven Wohlbefindens und der sozialen Beziehungen betrifft, so erlaubt der aktuelle Forschungsstand zweifellos, das mal auszuprobieren. Und zwar in guten, wie in schlechten Zeiten – so wird das gemeinsame Essen in der Konfliktliteratur aufgrund seiner hohen Symbolkraft als ein probates Mittel zur Deeskalation und Kontakt(wieder)herstellung diskutiert.
Helliwell, J. F., Layard, R., Sachs, J. D., De Neve, J.-E., Aknin, L. B., & Wang, S. (Hrsg.). (2025). World Happiness Report 2025. University of Oxford: Wellbeing Research Centre. (Kapitel 3).
Jiranek, H./Edmüller, A. (2021). Konfliktmanagement. Konflikten vorbeugen, sie erkennen und lösen.
6. Aufl. Haufe: Freiburg, S. 245f.
03.06.2025
LEADERSHIP IN A NUTSHELL (10): Die Kraft des Wir? So kann es klappen
Nach meinen Posts zu Varianten sowie Chancen und Risiken von geteilter Führung in Kulturorganisationen geht es heute abschließend um die Gelingensbedingungen. Wieder liegt der Fokus auf Co-Leadership mit zwei Führungspersonen im Top Management, wobei vieles auch für andere Modelle gilt.
- Bereitschaft, die Arbeitsbeziehung zu pflegen: An keiner Stelle sonst in der Organisation ist es so wichtig, dass die Arbeitsbeziehung aktiv gestaltet und gepflegt wird. Schlüsselwörter wie Vertrauen, Commitment, Transparenz, Fairness haben aufgrund der Strahlkraft in alle anderen Bereiche besondere Bedeutung. Eine belastbare Arbeitsbeziehung, die nicht bei jedem Sturm aus der Kurve getragen wird, ist das Ziel.
- Wille, zu kommunizieren: Dieses Führungsmodell erfordert hohe Kommunikationsbereitschaft, weil laufend Informationsasymmetrien abgebaut, Missverständnisse aus dem Weg geräumt werden müssen. Von täglichen Check-Ins, über digitale Visionboards bis hin zu regelmäßigen Jour Fixes und Mittagspausen ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. Den anderen im eigenen Handeln mitzudenken, so lässt es sich auf den Punkt bringen.
- Fähigkeit, Konflikte zu führen und zu regulieren: Führung teilen ist kein Honigschlecken. Unterschiedliche Auffassungen zu strategischer Ausrichtung, Zielen, Werten, Haltungen sind die Regel, nicht die Ausnahme. Aufgrund des Mehrwerts gut geführter Konflikte für die Organisationsentwicklung, ist es wichtig, dass sich zwei mit ihren Triggerpunkten auskennen und Konflikte sowohl aktiv eingehen als auch beruhigen können.
- Bereitschaft, sich selbst zu reflektieren: Was will ich als Teil des Führungsduos? Welche Werte und Haltungen sind für mich wichtig, ggf. unverhandelbar? Wo kann ich Zugeständnisse machen und Entscheidungen mittragen? Um was geht es mir eigentlich, wenn ich Themen vorantreibe oder einbremse? Das sind Fragen, die der eigenverantwortlichen Selbstreflexion bedürfen.
- Einbindung Dritter: Sollte spätestens dann in Erwägung gezogen werden, wenn es in der Dyade einfach nicht klappen will. Durch die externe Unterstützung können Erwartungen, Haltungen, Bedürfnisse etc. abgeglichen und u.U. harmonisiert werden. Manchmal wird die Erkenntnis aber auch sein, dass eine vorzeitige Trennung das Beste ist.
- Sensibilisierung von Auswahl-/Findungskommissionen: Berichte von Bewerbungsprozessen, in denen die zweite Person ohne Einbeziehung der ersten gesucht wurde, lassen mich etwas ratlos zurück. Sollte es nicht ein Anliegen der zuständigen Kommissionen sein, auch die soziale Passung der künftigen Doppelspitze im Blick zu behalten und zu prüfen, ob das künftige Duo komplementäre Kompetenzen hat und sich zur geteilten Führung bekennt?
01.06.2025
LEADERSHIP IN A NUTSHELL (9): Die Kraft des Wir? Chancen und Risiken geteilter Führung
Von echten Doppelspitzen, Co-Leadership im Jobsharing, über kollektive Führung und Shared Leadership gibt es verschiedene Varianten geteilter Führung in Kulturorganisationen. Und es gibt gute Gründe für die Verteilung von Führungsaufgaben auf mehrere Schultern. So ist das Führungsmodell prinzipiell geeignet, um Kulturorganisationen in unserer dynamischen, komplexen Arbeitswelt agiler, innovationsfreudiger, resilienter aufzustellen. Es gibt allerdings auch nicht wenige Risiken, die mit geteilter Führung verbunden sind – und die zu organisationaler Schwerfälligkeit, Innovationsaversion und Labilität führen können. In meiner Infografik dazu liegt der Fokus auf Co-Leadership zwischen zwei Führungskräften im Top Management.
Weil für andere Varianten von Co-Leadership (siehe vorheriger Post) andere bzw. zusätzliche Risiken gelten, möchte ich nachfolgend noch auf zwei Besonderheiten eingehen:
Die Führungsspitze besteht aus drei Personen, es entsteht also ein Beziehungsdreieck. Das geht im besten Fall gut, weil sich Mehrheiten und Koalitionen, z. B. bei Entscheidungen, sachorientiert immer wieder neu bilden können. Im anderen Fall kann es allerdings passieren, dass sich in der Triade dauerhaft zwei Beteiligte stärker verbunden fühlen, der/die Dritte also oft – tatsächlich oder gefühlt – außen vor ist. Das kann viele Gründe haben: Zwei haben gemeinsam angefangen, kennen sich aus anderen Projekten, teilen denselben fachlichen Background etc. etc. Wird diese dyadische Allianz nicht aufgelöst, bleibt der dritten Person also der Zugang zu wichtigen Ressourcen (Einfluss, Kontrolle, Informationen etc.) dauerhaft verwehrt, so wird dieses Führungsmodell vorzeitig scheitern (und wegen der Konfliktanfälligkeit persönlichen und organisationalen Schaden anrichten).
Führungskollektive sind unterschiedlich groß, von vier über sechs bis acht Personen findet sich einiges (u. a. abhängig von der Anzahl der Sparten/Geschäftsbereiche). Hier gilt es die mit wachsender Kollektivgröße exponentiell ansteigenden Kommunikationsbeziehungen im Blick zu behalten: Während 4 Personen 6 Kommunikationslinien haben, entstehen bei 6 Personen bereits 15, wenn alle mit allen direkt sprechen wollen. Diese Komplexität lässt sich nicht nur theoretisch berechnen (KL = n⋅(n−1)/2), sondern viele, die Teil solcher Führungskollektive waren, stellen auch ganz praktisch fest, was es bedeutet, wenn alles so intensiv miteinander diskutiert werden muss ( Inhalte, aber z. B. auch Führungsstile, Umgang mit Konflikten, Krisen, Stakeholdern), dass am Ende viel zu wenig Zeit für das Eigentliche, die Kunst, die Inhalte, bleibt. Erschwerend kommt hinzu, dass auch ein kollektives Leitungsmodell nicht als Selbstläufer vor Machtmissbrauch schützt.
28.05.2025
LEADERSHIP IN A NUTSHELL (8): Die Kraft des Wir? Führung teilen in Kulturorganisationen (I)
Kulturorganisationen müssen sowohl künstlerisch (inhaltlich/wissenschaftlich) als auch kaufmännisch geführt werden. Beide Aufgaben sind anspruchsvoll, benötigen eigene Kompetenzen und können selten durch eine Person allein abgedeckt werden. Vor allem für größere Kulturorganisationen – in anderen Fällen auch aufgrund des expliziten Wunschs der Träger – wird seit einigen Jahren das Modell der geteilten Führung propagiert.
Geteilte oder plurale Führung – englisch: Co-Leadership – bedeutet im Kern nichts anderes, als dass sich zwei oder mehr Personen Verantwortung teilen und Entscheidungskompetenzen kombiniert werden. Ab hier besteht dann weniger Einigkeit in Forschung und Praxis, vielmehr gibt es viele Varianten dieses Führungsmodells und einiges an Begriffswirrwarr.
- Co-Leadership 1: Zwei Personen m Top-Management teilen sich die Leitungsaufgaben, z.B. Intendanz und Verwaltungsleitung. Da die Aufgabenbereiche unterschiedlich sind, wird auch von "Führungsdual" oder "funktionaler Doppelspitze" gesprochen. Sind die beiden hierarchisch gleichberechtigt, dann wird as als "echte Doppelspitze" bezeichnet, sind sie es nicht, dann als §unechte Doppelspitze". Letzteres ist häufiger der Fall, da künstlerisch/inhaltliche Führung als vorrangig betrachtet wird.
- Co-Leadership 2: Es gibt eine Vollzeitstelle im Top-Management (z.B. Museumsleitung), die aber von zwei gleichrangigen Personen als Führungstandem in Teilzeit ausgefüllt wird. Der im Post verlinkte Beitrag von Christina Ludwig aus dem Kultumanagement Network Magazin gibt hier interessante Einblicke. Diese Variante findet sich auch im mittleren Management und ist eine Form des Jobsharings.
- Co-Leadership 3: Vor allem im Bereich der Darstellenden Kunst gibt es aufgrund der problematischen Machtkonzentration Bestrebungen, mehr als zwei Personen mit formal voneinander abgegrenzten Führungsaufgaben auf oberster Hierarchieebene zu installieren. In der Literatur wird dies als "verteile Führung" (Distributed Leadership) bezeichnet, die Theaterpraxis spricht von "kollektiver Führung". So hat das Theater Rampe in Stuttgart kurzfristig mit drei Spitzen experimentiert, auch im Theater Erfurt war ab 2027 eine Team-Intendanz geplant (steht aus kommunalrechtlichen Gründen allerdings derzeit zur Disposition). Am Deutschen Nationaltheater beweist sich ab der Spielzei 25/16 ein 4er-Kollektiv in der Theaterleitung.
- Shared bzw. Collective Leadership: Im Deutschen auch als "gemeinschaftlich geteilte Führung" bezeichnet, wird in der Theorie hierunter ein Führungsmodell verstanden, bei dem auch Teammitglieder Führung übernehmen sollen ('Führung durch viele'). Dieses Begriffsverständnis finde ich persönlich wenig überzeugend, da jede gute Führungskraft Mitarbeitende darin untersttzen wird, Verantwortung für Entscheidungen in ihrem Aufgabenbereich zu übernehmen. Daher verwundert es auch nicht, dass Shared Leadership in der Kulturpraxis häufig im Wortsinn genutzt wird, nämlich als geteilte Führung, meist im Top Management - und damit eine der o.g. Varianten des Co-Leadership darstellt.
Seltenes Glück, es gibt tatsächlich aktuelle Literatur aus dem Kulturmanagement zum Thema: Reid, W./ Fjellvær, H. (2023). Co-Leadership in the Arts and Culture. Sharing Values and Vision. Routledge: Oxon. Sowie frisch aus der deutschen Praxis ein Interview mit Dr. Christina Ludwig im Interview mit Kristin Oswald (2025): Aus eins mach zwei. In: Kulturmanagement Network Magazin, Jan/Feb 2025, Nr. 182, S. 73-78. Betriebswirtschaftliche Literatur: Endres, S./Weibler, J. (2019). Plural Leadership. Eine zukunftsweisende Alternative zur One-Man-Show Wiesbaden: Springer.
Spoiler alert: Ich blicke auf dieses Thema nicht allein aus theoretischer Perspektive, bin vielmehr selbst seit über 8 Jahren Teil eines solchen Führungsmodells. Ich habe mich damals bewusst dafür entschieden, nach über 14 Jahren universitätstypischer "Alleinherrschaft". Bewusst heißt, ich war mir im Klaren darüber, dass geteilte Führung Entwicklungsschritte verlangen wird, wenn sie funktionieren soll. It was not always easy… Daher geht es in einem nächsten Post mit den Chancen, Herausforderungen und Gelingensbedingungen weiter.
13.05.2025
WAS SAGT DIE FORSCHUNG (2)? Arbeiten im Homeoffice - Impulse für Kulturorganisationen
Eine der größten Veränderungen in der Arbeitswelt von Kulturorganisationen ist die Abnahme der Büropräsenz und die Zunahme von Homeoffice. Auf das Thema kann man aus unterschiedlichen Perspektiven gucken (Teamzusammenhalt, Mental Health, Vereinbarkeit etc.) und die Diskussion wird an vielen Stellen emotional geführt. Was aber sagt die Forschung zum aktuellen Stand diesbezüglich? Das Future Work Lab der Universität Konstanz führt unter der Leitung von Florian Kunze seit 2020 Studien zum Thema durch, deren Ergebnisse auch für Kulturorganisationen interessant und nutzbar sind:
- Der Wunsch nach Homeoffice und mobilem Arbeiten bleibt hoch (im ∅ 2,77 Tage). Interessant sind dabei die Abweichungen nach oben (Mitarbeitende ohne Führungsverantwortung: ∅ 2,9 Tage) und unten (Mitarbeitende mit Führungsverantwortung: ∅2,63 Tage).
- Knapp drei Viertel der Befragten gaben an, dass sie bei künftiger Jobsuche stark darauf achten werden, dass der Arbeitgeber Homeoffice und mobiles Arbeiten anbietet (71 Prozent).
- Nur knapp ein Fünftel der Befragten (19 Prozent) berichtet aus dem eigenen Arbeitsumfeld eine Rückkehr zur Präsenzpflicht. Interessant: Mehr Präsenz wird v.a. von jenen Arbeitgebern verlangt, die Personal abbauen wollen (und offenbar darauf setzen, dass jene Personen, denen eine flexible Arbeitsform wichtig ist, selbst kündigen).
- Starre Anwesenheitsregelungen führen zu keinem messbaren Produktivitätsgewinn, resultieren aber tendenziell in mehr Erschöpfung. Die Ergebnisse sind hier nicht ganz eindeutig, es darf vorsichtig vermutet werden, dass verstärkte Präsenzpflicht Konsequenzen für Mental Health und Mitarbeitendenbindung hat.
Die Einstellung von Führungskräften hat sich zum Positiven verändert. Es ist ihnen in den vergangenen Jahren offenbar gelungen, erfolgreich neue Formen der Arbeitsorganisation zu implementieren, insbesondere mit Blick auf Kommunikation und Prozesseffizienz. Allerdings: Je höher die Führungsebene, desto kritischer bleibt die Einstellung zum mobilen Arbeiten. So wünscht sich ein Drittel im Top Management eine stärkere Präsenzpflicht (32 Prozent) gegenüber 27 Prozent im mittleren Management und nur 16 Prozent im unteren Management.
Mögliche Rückschlüsse für Kulturorganisationen:
- Flexible, hybride Arbeitsformen sollten auch im Kulturbereich zu einem strukturellen Element moderner Arbeitskultur gehöen, in jedem Fall dort, wo die Aufgabenfelder es zulassen. Die Möglichkeit zur Integration von Homeoffice und Büropräsenz wird von umworbenen Fachkräften mittlerweile vorausgesetzt.
- Der Unterschied bei Mitarbeitenden mit und ohne Führungsverantwortung hinsichtlich der konkreten Zahl von Präsenztagen ist sachlogisch naheliegend. Führungskräfte müssen nun mal das große Ganze im Blick behalten. Und nicht alles lässt sich dauerhaft via E-Mail, Zoom & Co. klären.
- Gerade strittige Themen oder Aufgaben, die besondere Kreativität und Teamspirit erfordern, brauchen gemeinsame Energie in einem Präsenzraum. Und manchmal muss man sich auch einfach mal in der Kaffeeküche auf den Füßen stehen und über Kuriositäten des Arbeitsalltags lachen; Spannungsabbau und Bonding, das so ohne weiteres nicht im virtuellen Raum zu haben ist.
- Als Führungskraft würde ich sagen: Eine eigene Haltung entwickeln und gleichzeitig offen bleiben für situative Faktoren und individuelle Bedürfnisse. Nicht alles kann und sollte möglich sein, zum Schutz der Zusammenarbeit und im Sinne der Performance. Der aktive Gestaltungsprozess im Team und das im Gespräch bleiben mit den Einzelnen erlaubt aber, mehrere Perspektiven unter einen Hut zu bringen, bzw. auszutarieren.
- Eine Rückkehr zur vollständigen Präsenzpflicht sollte dabei in jenen Kulturberufen, die Homeoffice grundsätzlich erauben, nicht zur Diskussion stehen.
- Last but not least weise ich immer wieder gerne darauf hin: Homeoffice bedeutet für jede*n etwas anderes. Von perfeker Lösung über Überforderung bis hin zu Isolation und Depression ist alle drin. Nicht immer merken Mitarbeitende (oder Führungskräfte) die negativen Auswirkungen früh genug, daher ist es m.E. eine gute Idee, über die Chancen und Herausforderungen im Gespräch zu bleiben und sich im Durchschnitt auf zwei, drei gemeinsame (!) Tage zu einigen.
- Was jedenfalls nicht unterschätzt werden sollte: In Präsenzzeiten können wir anders in Resonanz gehen - und unser Gegenüber in Gänze wahrnehmen (und eben nicht nur als "floating head" ;) ).
Sample, Methode & Quelle:
Stichprobe der Erwerbsbevölkerung; bislang sind insgesamt 18 Befragungswellen in Zusammenarbeit mit dem Online Dienstleister Bilendi durchgeführt worden. Im März 2025 wurden 1.007 Personen befragt
Kunze, F./Hampel, K. (2025): Zwischen Präsenzpflicht & Homeoffice-Euphorie. Stand des mobilen Arbeitens fünf Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie, verfügbar unter: https://lnkd.in/eB3aTWf9 (abgerufen am 17. April 2025)
18.04.2025
Was sagt die Forschung (1)? Weniger arbeiten = gesünder und zufriedener in Kulturorganisationen?
Wie immer bei neuen Konzepten erfährt auch die 4-Tage-Woche eine gewisse Hype. Dies begründet sich u.a. in der Annahme, dass eine verkürzte Arbeitswoche für Vollzeitkräfte die Gesundheit, Arbeitszufriedenheit und Performance fördert. Insofern dockt das Konzept an der sehr aktuellen arbeitswissenschaftlichen Frage an, wie es angesichts des demografischen Wandels und eines sinkenden Arbeitsangebots gelingen kann, die Gesundheit und Erwerbsfähigkeit der Einzelnen über ein längeres Erwerbsleben zu wahren. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat dazu eine Studie vorgelegt, deren Ergebnisse auch für Kulturorganisationen interessant sind.
Im Überblick:
- Rund 37 Prozent der Beschäftigten in Deutschland arbeitet in so genannter „normaler Vollzeit“, d.h. zwischen 35 und 40 Wochenstunden.
- Wer Vollzeit arbeitet, ist nicht erschöpfter als Mitarbeitende in Teilzeit – weder körperlich noch emotional.
- Unabhängig von der Arbeitszeit ist die Arbeitszufriedenheit in beiden Gruppen hoch und auch der allgemeine Gesundheitszustand unterscheidet sich kaum.
- Nur wer mehr als 48 Wochenstunden arbeitet, hat ein erhöhtes Risiko für körperliche und emotionale Erschöpfung. Besonders betroffen sind - nicht überraschend - jene, die regelmäßig Überstunden leisten.
- Allerdings gilt grundsätzlich: Individuelle tätigkeits- und personenbezogene Merkmale bestimmen den Zusammenhang zwischen der Länge der Arbeitszeit und den (wahrgenommenen!) negativen Auswirkungen. So erleben z. B. Führungskräfte, die regelmäßig mehr als 48 Wochenstunden arbeiten, ihre Arbeit nicht als weniger attraktiv aufgrund ihrer größeren Handlungsspielräume bei der Arbeitsgestaltung.
Sample & Methode:
Datengrundlage bilden faktisch anonymisierte Daten der BAuA-Arbeitszeitbefragungen aus 2021 und 2015. Diese Befragung wird alle zwei Jahre erhoben und umfasst Personen ab 15 Jahren in Privathaushalten in Deutschland, die mindestens einer Erwerbsarbeit im Umfang von zehn Wochenstunden nachgehen.
Quelle:
Hammermann, A. (2025): IW-Trends Zum Zusammenhang zwischen Länge der Arbeitszeit und Erschöpfungszuständen: Eine Analyse auf Basis der BAuA-Arbeitszeiterhebung, Köln.
14.04.2025
LEADERSHIP IN A NUTSHELL (7): Soll ich Deine Verantwortung tragen?
Ein Dauerthema für Führungskräfte in Kulturbetrieben ist das Finden der richtigen Balance zwischen Fördern und Fordern, zwischen Delegieren und selbst machen, zwischen Verantwortung übernehmen und Verantwortung einfordern. Einige Überlegungen hierzu:
Unter Verantwortung wird hier die begründete Zuständigkeit oder Verpflichtung verstanden, die bei jemandem für etwas und gegenüber jemandem liegt. Führungskräfte haben z. B. qua Position und Rolle die Verantwortung gegenüber ihrem Team, Ziele zu setzen, Orientierung zu geben, Entscheidungen zu treffen und Ressourcen zu verteilen.
Nun wird häufig bemängelt, dass Führungskräfte zu wenig Verantwortung übernehmen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass man sich als Führungskraft schnell daran gewöhnen kann, Verantwortung zu übernehmen – und dieser Modus Operandi dann zu einem kaum noch reflektierten Automatismus wird. Und auch Mitarbeitende gewöhnen sich an ein solches Sicherheitsnetz.
Wer hier als Führungskraft nicht aufpasst, landet bald in der Verantwortungsfalle. D.h. er/sie übernimmt auch dort Verantwortung, wo eigentlich die Mitarbeitenden gefragt wären. (Und dies vielleicht auch gerne wollen würden – aber das ist ein anderer Post). Eine Überlastung mit entsprechenden Konsequenzen (fehlender Fokus, Schnellschuss-Entscheidungen, Unzufriedenheit, Krankheit etc.) ist zwangsläufig.
Helfen kann die Denkfigur des Führens mit dem Prinzip der Selbst- bzw. Eigenverantwortung. Hier verstanden als die freiwillige, aktive Bereitschaft von Mitarbeitenden – im Sinne eines bewussten Wählens und Wollens –, Verantwortung für das eigene Handeln am Arbeitsplatz (aber natürlich auch
für das Unterlassen bzw. Nicht-Handeln) zu übernehmen und Konsequenzen zu tragen. Der Satz „das hat man mir so gesagt“ verweist zugespitzt auf eine Organisationskultur, in der diese Selbstverpflichtung eher schwach ausgeprägt ist.
Verantwortungsbewusste Führungskräfte (und von denen handelt dieser Post) prüfen Verantwortungszuschreibungen und weisen sie bei Bedarf zurück, z.B. dann, wenn Aufgaben unvollständig abgeliefert oder notwendige Entscheidungen (ohne Vorstrukturierung und Vorabwägung der Alternativen!) angetragen werden. Gleichzeitig halten sie bei dieser Verantwortungsrückübertragung Stellensituation und -inhabende im Blick. Insbesondere auch wenn es einen „stretch“ braucht, um mitarbeiterseits an neuen Verantwortungen zu wachsen.
Diese Denkfigur ist m.E. keine leichte Übung. Vielmehr ist ein kontinuierliches Austarieren, Einüben und Rückmelden notwendig. Das ändert nichts am Ziel: Ein bewussterer Umgang damit, wer für was Verantwortung übernehmen darf, soll und muss. Und nicht durchgehen zu lassen, wenn jemand unter ihrer/seiner Verantwortung bleiben möchte.
24.03.2025
LEADERSHIP IN A NUTSHELL (6): Kulturbetriebe entwickeln – wie umsetzen?
Anknüpfend an meinen letzten Post zur Organisationsentwicklung geht es heute in medias res: Wie gut durch die Umsetzungsphase kommen? Nachstehend einige Tipps für Kulturbetriebe:
Passgenaue Maßnahmen entwickeln: Veränderungsmaßnahmen greifen am besten, wenn sie auf die Situation vor Ort zugeschnitten sind – und wenn sie mit und von den Mitarbeitenden entwickelt werden. Das braucht Zeit und oft mehrere Schleifen, aber das lohnt sich.
- Kommunikation, Teilhabe, Transparenz: Viele der in der Infografik aufgeführten Methoden eignen sich, um Teilhabe zu fördern und Räume für Austausch zu schaffen. Es sollte Mitarbeitenden möglichst leicht gemacht werden, zu wissen, wo der Prozess gerade läuft, hängt oder justiert wird.
- Quick Wins anpeilen & Meilensteine feiern:
- Jeder Veränderungsprozess stößt auf Hürden und Ermüdungserscheinungen sind vorprogrammiert. Kleine Erfolge sichtbar zu machen und größere Meilensteine bewusst zu feiern, hält die Motivation hoch, sorgt für neuen Schwung und macht Ergebnisse greifbarer.
- Konflikte nutzen: OE wirkt oft als Katalysator für bestehende Konflikte. Und Störungen haben Vorrang, da ansonsten Stagnation oder Überlastung des Veränderungsprozesses droht. Konflikte daher möglichst adressieren und regulieren, bevor nächste Projektschritte (vorschnell) eingeleitet werden.
- Fähigkeiten fördern: Keine OE ohne Kompetenzentwicklung! Veränderungen gelingen, wenn Mitarbeitende mitgenommen werden. Gezielte Weiterbildung, z. B. in neue Arbeitsmethoden, baut Ängste ab, fördert die Arbeitszufriedenheit und erhöht die Personalbindung.
- Fehler als Lerngeschenke: Neues wird ausprobiert – und dabei werden Fehler entstehen. Statt den Schuldigen zu suchen, lieber daraus lernen und weiter gehts. Dazu braucht es in Kulturbetrieben auch Führungskräfte, die den Mut haben, Räume zu schaffen, in denen Teams eigenverantwortlich und selbstorganisiert Lösungen testen können.
Tools in der OE: Schifferer, S./von Reitzenstein, B. (2017). Tools und Instrumente der Organisationsentwicklung, Springer: Wiesbaden; Hands-on Tools für die Arbeit in und mit Gruppen: Paar, K. (2023). Workshops machen. Campus: Frankfurt am Main.
22.02.2025
LEADERSHIP IN A NUTSHELL (5): Kulturbetriebe entwickeln – wie starten?
Organisationsentwicklung beschreibt einen systematischen, zielorientierten, langfristigen und partizipativen Veränderungsprozess in Kulturbetrieben. In unserem demnächst im Springer Verlag erscheinenden Leitfaden stellen wir u. a. praxiserprobte Tools für den Start, die Umsetzung und die Evaluation solcher Prozesse vor. In der Startphase geht es darum, die aktuelle Situation im Kulturbetrieb zu analysieren (z. B. durch Dokumentenanalysen, Interviews, Mitarbeitendenbefragungen) und die Beschäftigten über das Vorhaben zu informieren und zur Partizipation einzuladen. Dies geschieht in Kick-Off-Veranstaltungen, in denen typischerweise folgende Fragen aufgerufen werden:
- Wer soll da mitmachen? Alle! Da das insbesondere in größeren Kulturbetrieben aus verschiedenen Gründen nicht der Fall sein wird: möglichst viele. Denn nur, wenn es gelingt, eine Mehrheit mit auf die Reise zu nehmen, werden die Veränderungen in der Breite getragen und Ideen als „eigene“ akzeptiert.
- Was soll geändert werden? Das, was geändert werden muss, um als Kulturbetrieb effektiver und effizienter zu agieren. Das reicht von Strukturen, Prozessen, Denkweisen bis hin zur Modi der Zusammenarbeit und internen Kommunikation.
- Wie lange soll das dauern? Im Prinzip gilt frei nach Sepp Herberger: Nach der Organisationsentwicklung ist vor der Organisationsentwicklung. Letztlich sind wir auf der individuellen und institutionellen Ebene gleichermaßen immer wieder gefordert, uns zu hinterfragen, zu entwickeln, neuen Gegebenheiten mit neuen Mechanismen zu begegnen. Andererseits: nobody „likes“ change, ein Status quo bietet Verlässlichkeit, Berechenbarkeit etc. Daher muss es immer auch Phasen der Erholung geben, in denen das Neue ausprobiert, eingeübt, angepasst und angenommen werden kann.
- Was soll uns das bringen? Eine ehrliche Antwort hierauf lautet: Viele Erfolgserlebnisse durch Selbstwirksamkeit, neues Miteinander, Einüben einer stärker interaktiven, partizipativen Arbeitskultur. Aber auch Mehraufwand durch Teilnahme an z. B. Workshops und Arbeitsgruppen, Scheitern von guten Vorsätzen und an bürokratischen Grenzen, Frustration durch Tempoverschlepper und Veränderungsblockiererinnen. Im Umgang mit den Herausforderungen kann es helfen, das Veränderungstempo zeitweise zu drosseln, Meilensteine neu zu setzen, kleinere Erfolgserlebnisse zu suchen, weitere Unterstützer am Wegesrand zu sammeln.
Anlässe für Organisationsentwicklung können sein:
- Organisationskultur (z.B. Werte, Leitbild, Führungsgrundsätze, Zusammenarbeit)
- Interne Kommunikation (z. B. Teambesprechungen, Jahresgespräche, abteilungsübergreifende Vernetzung)
- Strukturen (z.B. Hierarchieebenen, Abteilungszuschnitte, Teamgrößen)
- Ziele und Strategien (z.B. nach Wechsel von Führungskräften, Neuausrichtung)
- Abläufe (z.B. Abstimmungsprozesse, Entscheidungsprozesse)
Klassiker der OE-Literatur: Schiersmann, C., & Thiel, H.-U. (2018). Organisationsentwicklung. (5. Aufl.). Wiesbaden: Springer; spannender Bericht aus der OE-Praxis: Wiesbauer, A. (2015): Organisationsentwicklung an einem Wiener Museum. Was können wir? Wohin wollen wir? In F. Look, U. Poser, G. Röckrath, O. Scheytt (Hrsg.), Handbuch Kulturmanagement. J. 1.19, (S. 97-114). Stuttgart: Raabe.
20.02.2025
LEADERSHIP IN A NUTSHELL (4): Navigieren in rauer See – Werte als innerer Kompass
Das Jahr ist noch jung, die Vorsätze noch groß. Mehr Fokussiertheit, mehr Gelassenheit, mehr Wertschätzung – es gibt vieles, was Führung in Kulturbetrieben guttun würde. Und dann bricht sich der Alltag jeden Tag mehr Bahn und vieles droht im Laufe der tickenden Jahresuhr verloren zu gehen. Mit der Fokussierung von Werten kann es gelingen, Vorsätze über die Zeit hinweg (gemeinsam) zu sichern:
- Werte besagen, wie es wünschenswert wäre, sich zu verhalten. Werte sind Zielvorstellungen für das Handeln in Arbeitskontexten, sowohl auf organisationaler, v.a. aber auch auf persönlicher Ebene. Werte beeinflussen – mehr oder minder bewusst – z. B. den Umgang mit Verantwortung, Fehlern oder Konflikten.
- Es gibt eine Fülle an Werten. In der seit 2006 durchgeführten Studie der Wertekommission werden z. B. Vertrauen, Verantwortung, Respekt, Integrität, Nachhaltigkeit und Mut als Kernwerte untersucht. Vertrauen bleibt dabei seit 5 Jahren der für die Befragten (in 2023 waren das 441 Führungskräfte aus unterschiedlichen Branchen) wichtigste Wert. In einem unserer letzten Workshops haben Kulturschaffende die Werte Verlässlichkeit, Transparenz und Fair Play ergänzt. Ich persönlich würde noch Humor und Großzügigkeit in den Ring werfen wollen.
- Träger von Werten sind Individuen und Kollektive. Führungskräfte, die sich regelmäßig mit ihren Werten befassen, haben einen inneren Kompass, der auch funktioniert, wenn der Wind im Kulturbetrieb rauer weht. Gleichzeitig orientieren sich Mitarbeitende und Teams an den Werten ihrer Führungskräfte und bringen eigene ein. Werte wirken – in einer permeablen Führungskultur – in beide Richtungen; im Idealfall stabilisierend und komplexitätsreduzierend.
- Werte sind von hoher Bedeutung für soziale Systeme. Werte können im Rahmen der Team-/Organisationsentwicklung genutzt werden, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Was wird konkret verstanden, wenn von Vertrauen und Verantwortung gesprochen wird? Gemeinsam geteilte Werte stärken den Zusammenhalt, die Anerkennung von Trennendem stärkt die Konfliktresilienz.
- Aus der gemeinsamen Diskussion können Handlungsrichtlinien (Normen) entstehen, die als Führungsleitlinien, Organisationsprinzipien etc. im Recruiting, in Personalgesprächen oder in der Konfliktmediation aktiv genutzt werden. Die Betonung liegt auf „aktiv“, denn Papier ist geduldig und es gilt der Aphorismus von Viktor E. Frankl: „Werte kann man nicht lehren, sondern nur vorleben“.
17.02.2025
IKM PRAXIS: Gemeinsam stärker – sich bewusst Zeit für den kollegialen Austausch nehmen
Im hektischen Alltagsgeschäft bleibt Führungskräften oft viel zu wenig Zeit, um gemeinsam innezuhalten. Gleichzeitig ist eine regelmäßige Rückschau auf individuelle Führungsherausforderungen oder die kollegiale Zusammenarbeit wertvoll, wenn es darum geht, die Führungsarbeit im Haus zu professionalisieren und weiterzuentwickeln. Gerade auch das Jahresende bietet einen guten Zeitpunkt, um sich als Führungsgremium ein paar kostbare Stunden Zeit für die gemeinsame Reflexion zu nehmen und mit neuen Ideen und guten Vorsätzen ins nächste Jahr zu starten.
In der vergangenen Woche hatten Lena Zischler und ich die schöne Aufgabe, eine solche Reflexion für ein Museum strukturiert anzuleiten und gemeinsam mit dem engagierten Führungskreis auszuloten, was bereits gut läuft und wo Entwicklungspotenziale bestehen. Folgende Erkenntnisse aus der lebhaften Diskussion möchten wir hier teilen:
- Priorisierungen sind wichtig. Kommt die Gruppe einmal ins Arbeiten, finden sich in der Regel mehrere Ansatzpunkte für Veränderung. Es gilt, die identifizierten Themen zu ordnen und zu entscheiden, was zuerst angegangen werden soll. Das hilft dabei, mehr Struktur zu schaffen, Ressourcen umsichtig einzusetzen und Überforderung im Change Prozess zu vermeiden.
- Vieles ist „normal“. Aushandlungsprozesse, Kontroversen, Macht- und Bedeutungsfragen, Zielkonflikte etc. sind typisch für Systeme. Es kann entlastend sein, das zu wissen.
- Häufig stellt sich bei der gemeinsamen Diskussion ein 'Aha-Effekt' und motivierendes Gemeinschaftsgefühl ein, wenn Kolleginnen und Kollegen ähnliche Herausforderungen erleben oder ähnliche Entwicklungsbedarfe sehen.
- Ritualisierte Auszeiten, Workshops und Klausurtagungen sind immens wichtig für Führungskräfte, die dort erarbeiteten Ergebnisse oft wegweisend für die Zukunftssicherung. Der Abschied von alten Gewohnheiten und das Etablieren neuer Verhaltensweisen, Strukturen und Prozesse erfordert jedoch einen langen Atem und tägliche Arbeit. Die Klärung von Verantwortlichkeiten, regelmäßige Treffen und die Bearbeitung konkreter Themen in Kleingruppen helfen dabei, dass die erarbeiteten Ergebnisse nicht im Alltag versanden, sondern nachhaltig wirken.
13.01.2025
LEADERSHIP IN A NUTSHELL (3): Konflikte eingehen, beruhigen und beilegen können
Konflikte sind ein Thema, das viele Menschen in Kulturorganisationen bewegt – und alle betrifft. Konflikte sind im Arbeitsleben allgegenwärtig und unvermeidlich. Sie konsumieren knappe Ressourcen und beeinflussen die Qualität unserer Arbeitsbeziehungen. Konflikte werden oft als zerstörerisch gefürchtet. Aber nicht selten können (nur) Konflikte Weiterentwicklung anstoßen und zu neuen, besseren Lösungen führen.
- Die meisten Menschen wollen Konflikte intuitiv vermeiden. „Das wird nicht so gemeint gewesen sein“, „So wichtig ist es mir eigentlich nicht“, „Ich warte jetzt erst einmal ab, was als nächstes passiert“, das sind beispielhafte Selbstberuhigungen, um Konflikten aus dem Weg zu gehen. Und häufig ist es eine gute Coping-Strategie, nicht alles auf die „Waagschale“ zu legen, sich innerlich frei von (vermeintlichen) Giftpfeilen zu machen, positiv zu denken und die anderen mit Humor und Nachsicht zu nehmen. Es kann in vielen Situationen sehr zielführend sein, einen Konflikt (bewusst) nicht einzugehen.
- In anderen Situationen kann es allerdings notwendig sein, einen Konflikt zu adressieren, ihn ggf. sogar zu schüren. Das ist z. B. dann der Fall, wenn sich Situationen von Ungerechtigkeit und Ungleichbehandlung wiederholen (z. B. bei der Verteilung von Ressourcen), Vereinbarungen gebrochen werden, Handlungen nur der persönlichen Machtsicherung, nicht aber dem Wohl des Gesamtsystems dienen. In solchen Fällen, insbesondere wenn sie immer wieder auftreten, kann es unumgänglich sein, sich stand- und wehrhaft zu zeigen und klare Grenzen aufzuzeigen.
- Wer bewusst abwägen kann, ob es in einer konkreten Situation sinnvoll ist, einen Konflikt einzugehen oder nicht, ihn zu beruhigen, zu schüren oder gar das Spielfeld zu verlassen, dem stehen mehr Möglichkeitsräume zur Verfügung. Das allein kann bereits das Gefühl der eigenen Wirksamkeit erhöhen und es ist nicht mehr ganz so wichtig, als „Sieger“ aus der Konfliktarena zu gehen. Denn in den meisten Konfliktsituationen hat auch das Gegenüber eine berechtigte Perspektive. Selten sind die Dinge nur schwarz oder nur weiß – diese Erkenntnis kann der Beginn einer klugen Konfliktregulierung sein.
Ein Post zum Thema Konflikte kann nicht enden ohne den wichtigen Hinweis: Respice finem! Konflikte entwickeln eine Eigendynamik, die nicht kontrollierbar ist. F. Glasl zeigt das anschaulich in seinem bekannten Phasenmodell der Eskalation. Gerade auch Führungskräfte mit ihren konflikthaften Rollenanforderungen und Aufgaben sind daher gut beraten, emotionale und kognitive Kompetenzen für die Regulierung von Konflikten zu erwerben – und sich darin kontinuierlich zu üben und weiterzuentwickeln.
19.12.2024
LEADERSHIP IN A NUTSHELL (2): Selbstführung – oder der Mehrwert von einem Moment innehalten.
Die Tage werden kürzer, das Jahr neigt sich dem Ende, der Wahnsinn in den Büros nimmt zu. Jedes Jahr aufs Neue soll alles noch bis Weihnachten geschafft werden. Und auch immer wieder neu gilt, dass nächstes Jahr alles besser werden soll. Eine gute Gelegenheit, um in diesem Kontext über die Stärkung der eigenen Selbstführungskompetenzen nachzudenken. Einige Key Facts to go:
- Selbstführung beschreibt den Prozess, sich selbst zu beeinflussen, zu steuern und zu motivieren. Zugrunde liegt die Fähigkeit, das eigene Denken, Fühlen und Handeln zu reflektieren, zu evaluieren und sich – ggf. mit Unterstützung Dritter – weiterzuentwickeln. Sich selbst gut führende Menschen übernehmen Verantwortung für ihren Teil an gelingenden oder weniger gelingenden (Führungs-)Situationen – und machen nicht äußere Umstände oder andere verantwortlich. Sie können mit Veränderungen aber auch mit Ohnmacht, Frustration, Nicht-Gelingen umgehen und lernen aus Fehlern. Selbstführung bedeutet in Alternativen denken zu können und sich dadurch Handlungsspielräume zu verschaffen.
- Selbstführung wirkt auf zwei Ebenen: Der primäre Effekt liegt darin, dass sich selbst gut führende Menschen ausgeglichener, leistungsstärker und zufriedener sind – Stress kann besser weggesteckt werden. Selbstführung hat damit enge Bezüge zu anderen Konzepten, wie z.B. Zeit- und Selbstmanagement, Resilienz und Mental Health.
- Der sekundäre Effekt liegt in verbesserten Arbeitsbeziehungen mit Mitarbeitenden, besserer Stimmung im Team, höherem Arbeitsengagement und höherer Performance des Teams. Damit wird die Vorbildfunktion bzw. das Steuerungspotenzial von Führungspersonen auch an dieser Stelle deutlich. Selbstführung erhöht die Qualität des Leaderships.
- Empirisch bewährte Strategien der Selbstführung* sind u.a.: Selbstzielsetzung; Selbstbeobachtung, Selbstgespräche & Journaling; mentales Probehandeln & Visualisierung erfolgreicher Leistungen; Evaluation eigener Glaubenssätze und Annahmen; Proaktive Denkhaltung & Rituale; Selbstbelohnung. Daneben können Dritte einbezogen werden (Trainings, Coaching, Mentoring etc.).
- Selbstführung braucht weiteres: Die Bedeutung von Schlaf ist nicht erst seit der Forschung von Matthew Walker, PhD mehr in den Fokus einer breiten Öffentlichkeit gerückt. Hinzu kommen Ernährung, Bewegung, soziale Kontakte, Spiritualität. No kidding.
Fazit: Selbstführung ist ein Element im Werkzeugkoffer des Leaderships, um andere gut führen zu können. Die vorbildlichste Selbstführung kann allerdings kein krankes System (Organisationsstruktur, -kultur, -abläufe) dauerhaft auffangen. Selbstführung und Organisationsentwicklung gehen idealerweise Hand in Hand.
15.12.2024
LEADERSHIP IN A NUTSHELL (1): Onboarding in Kulturorganisationen – emotionale Bindung stärken
Heute Nachmittag spreche ich mit Theaterschaffenden über das Onboarding als wichtigem Element von professionellem Recruiting. Dabei geht es auch um konkrete, praxisnahe Maßnahmen für eine gelingende Integration von neuem Personal gehen - basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Onboarding. Sechs Key Facts to go:
- Soziale Maßnahmen haben den größten positiven Effekten auf die Integration von Neuen. Hierzu gehören v.a. Interaktionen mit erfahrenen Organisationsmitgliedern, die z.B. als Mentor oder Mentorin unterstützen. (Inhalts-/kontextbezogene Maßnahmen sind Must-haves im Onboardingpaket, aber für die emotionale Bindung nachgeordnet wichtig).
- Das Arbeitsteam spielt – nicht überraschend – eine zentrale Rolle für die erfolgreiche Eingliederung: Je besser die emotionale Bindung an das Team gelingt, desto mehr sinkt die kognitive Dissonanz („habe ich mich für den richtigen Arbeitsplatz entschieden?“) und die Kündigungsabsicht. Gleichzeitig können früh Schnittstellenproblematiken adressiert werden.
- Das bedeutet auch: Aufgaben und Rollen innerhalb des Onboardings werden auf mehrere Schultern verteilt. Führungskräfte wirken stärker auf der strategischen Ebene und behalten das große Ganze im Blick – das Team konzentriert sich auf operative Maßnahmen. Schöner Nebeneffekt: Eine solche Verantwortungsteilung wirkt sich positiv auf das bestehende Team aus.
- Die Rolle von Führungskräften wird damit nicht weniger wichtig: Die Festlegung von Aufgaben und Verantwortungen, der Abgleich von Erwartungen und die Prüfung des Fit von Werten und Zielen, das alles bleibt in ihrem Aufgabenbereich.
- Zeitlich gesehen sind die ersten sechs Monate entscheidend für Zufriedenheit, Performance und Bleibeabsicht der neuen Person. Dabei fangen vorausschauende Führungskräfte und Teams bereits vor dem ersten Arbeitstag damit an, (ausgewählte!) Interaktionen anzustoßen (Preboarding).
- Zielgruppenspezifisches Onboarding ist sinnvoll => Erfahrene Neueinsteigerinnen haben andere Bedürfnisse und Erwartungen als neue Mitarbeiter, die gerade ihre Ausbildung beendet haben und erst einmal ein Gefühl für Strukturen und Institutionen entwickeln müssen.
Fazit: Ein „strukturiertes Onboarding“ mit einem definierten Prozess und eindeutigen Verantwortlichkeiten (Abteilung/Stelle Personal, einstellende Abteilung etc.) macht viel Sinn. Wer jetzt aufstöhnt und sagt, was denn noch alles, dem sei eine Abwägung empfohlen: Auswirkungen des Nichtgelingens (mehrere Bewerbungsverfahren, Demotivation bei den Beteiligten, Imageschaden, Arbeitsüberlastung während der Vakanz etc.) vs. mehr Struktur, Gelingenserfahrung, Teamspirit und Zufriedenheit.
29.11.2024